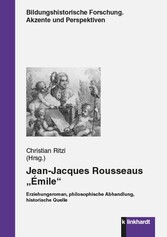Suchen und Finden
Service
Mehr zum Inhalt

Jean-Jacques Rousseaus „Émile“ - Erziehungsroman, philosophische Abhandlung, historische Quelle
Jean-Jacques Rousseaus„Émile“
1
Impressum
4
Inhaltsverzeichnis
6
Christian Ritzi:Einleitung
8
Otto Hansmann:Rousseaus anthropologische Provokation undKulturkritik als Begründung seiner Theorienegativer und natürlicher Erziehung
16
Erstens zum Gedankenexperiment und der daraus gewonnenen Erkenntnis.
18
Zweitens zum Konzept der negativen und natürlichen Erziehung.
25
Was folgt daraus für die moderne Pädagogik?
26
Quellen und Literatur
28
Heinz-Elmar Tenorth:Eine Bildungstheorie bei Rousseau?
30
I.
30
II.
32
III.
34
IV.
38
Quellen und Literatur
41
Fritz Osterwalder:Rousseaus „Émile“ – ein sakrales Ereignis
44
1. Religiöse Muster der Pädagogik vs. republikanische Muster
47
2. Der theologische und glaubenspraktische Kontext der Frömmigkeitsbewegungen des 17. Jahrhunderts und seine Pädagogisierung
50
3. Die religiöse Sprache von Rousseaus Pädagogik
58
4. Schluss: Rousseaus „Émile“ als theologisches Ereignisvon 1762
63
Quellen und Literatur
67
Christophe Losfeld:Die Höflichkeitskritik Rousseaus im Kontext
70
1. Legitimierung der Höflichkeit im frühen 18. Jahrhundert
70
2. Duclos’ „Considérations sur les moeurs de ce siècle“
72
3. Toussaints „les Moeurs“
76
4. Rousseaus radikale Kritik der Höflichkeit
78
Quellen und Literatur
86
Frank Tosch:„… das Buch der Natur aufzuschließen und zuerklären“
90
Einleitung: Erkenntnisinteresse und Fragestellungen
90
I.
92
II. Rousseaus didaktischer Vermittlungsansatz in den „Lettres elementaires sur la botanique“ 1771 bis 1773/74 (?)
101
III. Zur Einordnung und Rezeption der Botanik im Werk von Rousseau – ein Deutungsversuch
110
Quellen und Literatur
114
Petra Steidl: „Ich muss zweifellos für diese Kunst geboren sein“Musik im Kontext der bildungs- und gesellschaftspolitischenGrundsätze des Jean-Jacques Rousseau unterBerücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse1
118
Einleitung: Das musikalische Leben und Wirken des Jean-Jacques Rousseau
118
I. Die Entstehung der melodiösen Ursprache des Menschen im Goldenen Zeitalter
120
II. Die Eigenschaften und Wirkungen der melodiösen Ur-Sprache unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse
124
III. Die einheitsstiftende Kraft der „volonté générale“ in musikalischen Stimmengemeinschaften
130
IV. Die Bildungs- und Musikphilosophie auf der Opernbühne und in kleinen Gesellschaften
135
Schluss
136
Quellen und Literatur
138
Christine Mayer:„... la femme est faite spécialement pour plaire àl’homme“Die Ordnung der Geschlechter bei Jean-Jacques Rousseau
140
1. Einleitung
140
2. Das ‚System Rousseau‘
143
3. Rousseaus Geschlechterkonzeption im „Émile“
146
4. Kontexte und Verknüpfungen im Geschlechterdenken Rousseaus
149
4. Zur Adaption der Rousseauschen Geschlechterkonzeption bei Kant und W. von Humboldt
159
5. Resümee
164
Quellen und Literatur
165
Werner Stark:Rousseau und Kant
170
I.
172
II.
177
III.
182
Quellen und Literatur
190
Daniel Tröhler:Kommerzialisierung der GesellschaftJean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi und diePädagogisierung der Vater-Sohn-Beziehung in der zweitenHälfte des 18. Jahrhunderts
194
1. Die ideologische Querelle des 18. Jahrhunderts
196
2. Die geschlechtsspezifische Konnotation des Konflikts
198
3. Das oppositionelle Konzept der republikanischen Exempel
201
4. Die reformierte Seele und deren Erziehung zum Bürger als Lösung des Konflikts
205
5. Kopplung von Fortschritt und Pädagogik
209
Quellen und Literatur
211
Hanno Schmitt:Joachim Heinrich Campes Reise zu RousseausGrab im Park von Ermenonville
214
1. Rousseau als inspirierender Impulsgeber
214
2. Campes Revolutionsbegeisterung und der Park von Ermenonville
217
3. Campes aufgeklärt-empfindsame Erfahrungen im Park von Ermenonville
220
4. Schlussüberlegungen
226
Quellen und Literatur
229
Simone Austermann:„Alles theils übertrieben, theils falsch“Kommentare zum „Émile“ durch die Gesellschaftpraktischer Erzieher und andere Gelehrte
232
Vorbemerkung
232
Die „Brauchbarmachung“ des Émile
233
Das Verhältnis zwischen Rousseau und den Kommentatoren
238
Die „gefrorene“ Diskussion
241
Die Kommentare als wichtiger Teil des Gelehrtendisputs
245
Quellen und Literatur
246
Eva Matthes:Rousseau in pädagogischen Nachschlagewerken
250
Untersuchte Pädagogische Lexika
268
Literatur
268
Joachim Scholz:Jean-Jacques Rousseau als Bezugspunkt derdeutschen Lebensreformbewegung
276
1. Lebensreform – eine rousseauistische Bewegung an der Schwelle des 20. Jahrhunderts
276
2. Etikettierung, Funktionalisierung und inhaltliche Reduktion Rousseaus in der Naturheilkundebewegung
279
3. „Zurück zur Natur“
282
4. Gestörte Passungsverhältnisse, verschobene Kontexte
285
Quellen und Literatur
291
Christian Ritzi:„Cette allégorie est belle et claire“Illustrationen des 18. Jahrhunderts aus französischenAusgaben von Jean-Jacques Rousseaus „Émile, ou Del’éducation“
294
I.
296
II.
301
Schluss
360
Quellen und Literatur
363
Personenregister
366
Autorenverzeichnis
374
Rückumschlag
376
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.